Publikationen
Heft 72: Jüdisches Geld gegenüber christlichen Waren.
"Zur Judenfrage" im "Kapital"
Von: Manuel Disegni
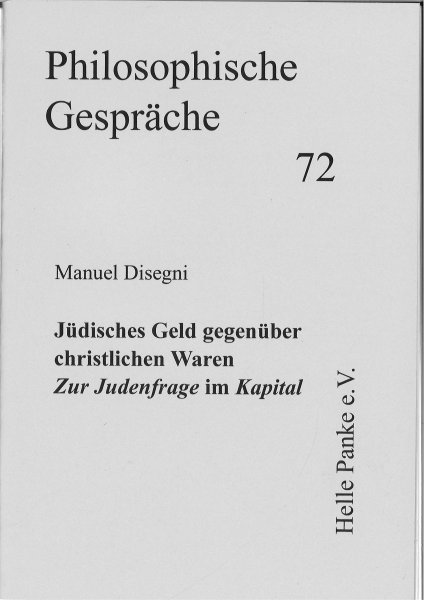
Reihe "Philosophische Gespräche", Heft 72, 44 S.
Am 13. Mai 2024 referierte Manuel Disegni im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philosophische Gespräche“ in der „Hellen Panke“, Kopenhagener Straße 9, Berlin. Vorliegender Text basiert auf seiner bisher nur auf Italienisch erschienenen Dissertation. Wir danken dem Autor für die Bereitstellung seiner Forschungsergebnisse für diese Publikation.
Autor
Manuel Disegni
hat in Berlin studiert und sich u.a. mit Walter Benjamins Philosophie beschäftigt. Er hat an der Universität Turin über Marx und Antisemitismus promoviert. 2024 ist bei Bollati Boringhieri "Critica della questione ebraica. Karl Marx e l'antisemitismo" erschienen.
_________________________
Inhalt
1. Einleitung. Welche Vorhaut?
2. Zur Judenfrage
3. Ware und Geld
4. Juden und Geld: eine archetypische Verbindung
5. Die „entsprechendste Religionsform“ für eine Gesellschaft von Warenproduzenten
6. Schlusswort
Literaturverzeichnis
_________________________
LESEPROBE
1. Einleitung. Welche Vorhaut?
Im Kapital von Karl Marx heißt es an einer Stelle, „daß alle Waren, wie lumpig sie immer aussehn oder wie schlecht sie immer riechen, im Glauben und in der Wahrheit Geld, innerlich beschnittne Juden sind“.[1]
Für viele Leserinnen und Leser würde diese Bemerkung – nebst den wenigen anderen Stellen in seinen Schriften, an denen auf Juden oder auf gängige Klischees über sie Bezug genommen wird – die antisemitischen Vorurteile ihres Autors verraten.[2] Ein elementares Niveau an Bibelkenntnis und Sinn für Humor dürfte jedoch ausreichen, um erkennen zu können, dass es sich hier um keine antisemitische Aussage handelt, sind doch gerade diejenigen „innerlich beschnitten“, die Paulus von Tarsus als „die echten Juden“ ausweist, nämlich die Christen. Die theologische Polemik des Paulus gegen den Ritus der Zirkumzision ist ein zentrales Motiv des traditionellen christlichen Judenhasses. Nach Ansicht des Apostels würde die christliche Offenbarung die Aufhebung von Israels Gesetz implizieren. Die Überlegenheit des Christentums gegenüber der Religion, von der es abstammt, würde darin liegen, dass die Christen den Geist des Gesetzes verinnerlicht haben, während die Juden an eine rein äußerliche Einhaltung des Buchstabens gebunden bleiben. Als äußerliches Zeichen ihres Bunds mit Gott ist die Beschneidung für Paulus ein Sinnbild der jüdischen Religiosität. Demgegenüber würde der theologische Fortschritt des Christentums sich darin zeigen, dass seine Anhänger diese rituelle Praxis unterlassen, da ihre Beschneidung, d.h. ihre Beziehung zu Gott, innerlich geworden ist, also auf dem Glauben und der Liebe beruht, die in ihrem Herzen wohnen, und nicht länger auf dem Wortlaut des Gesetzes. Darum spricht Paulus von einer „Beschneidung des Herzens“.[3]
Da nun die Juden bekanntermaßen sich nicht am Herzen zu beschneiden pflegen, liegt es auf der Hand, dass diese höhnische Anspielung von Marx auf den apostolischen Brief an die Römer im profanen Zusammenhang einer materialistischen Kritik der politischen Ökonomie keinen judenfeindlichen Sinn ergeben kann. Allenfalls ließe sie sich als polemisch gegenüber dem paulinischen Christentum verstehen. Aber wie genau? Was haben Waren und Geld mit Christentum und Judentum zu tun?
Der vorliegende Aufsatz soll in erster Linie den Sinn dieses Witzes über die innere Beschneidung verdeutlichen. Jenseits der bloßen Textanalyse geht es aber nicht nur darum, mit der verleumderischen Legende von Karl Marx´ Antisemitismus aufzuräumen. Es sollen ferner Argumente dafür geliefert werden, dass:
1) Marx, weit davon entfernt, mit dem wachsenden Antisemitismus seiner Zeit zu sympathisieren, vielmehr dessen erster Kritiker gewesen ist, d.h. der erste, der ihn nicht nur für ein Überbleibsel traditioneller Vorurteile gehalten, sondern als ein spezifisches Produkt der modernen kapitalistischen Gesellschaft erkannt hat;
2) das Problem des modernen Antisemitismus einen untergründigen thematischen Strang in seinem Werk bildet, der zwar nur an wenigen verstreuten Stellen in seinen Schriften und fast immer in Form von ironischen und kryptischen Anspielungen an die Oberfläche tritt, tatsächlich aber in allen wichtigen Etappen seines Denkens, von der frühen Kritik der deutschen Ideologie und Philosophie bis zu den späteren Kritiken des französischen Sozialismus und der klassischen politischen Ökonomie, eine entscheidende – in der bisherigen Rezeptionsgeschichte aber fast völlig übersehene – Rolle spielt;
3) seine kritische Theorie der bürgerlichen Gesellschaft einen systematischen Beitrag zum Verständnis des Wesens und der Ursachen des modernen Antisemitismus liefert – möglicherweise das am meisten verkannte seiner wissenschaftlichen Verdienste.
Die für Marx´ Prosa charakteristische Ironie und Sarkasmus sind nicht nur eine rhetorische Schrulle und auch kein bloßes polemisches Mittel. Vielmehr haben sie einen echten dialektischen Eigenwert und Erkenntnisgehalt. Oft erfüllen sie nämlich eine wichtige Funktion in der Entwicklung der Gedanken und Argumentationen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es um Religion geht. Es versteht sich jedoch von selbst, dass die Klärung einer geistreichen Bemerkung keine erschöpfende Behandlung eines so ernsten und vielschichtigen Themas in einem so umfangreichen und komplexen Werk abgeben kann. Dies kann auch nicht das Ziel eines kurzen Aufsatzes sein. Daher können die drei genannten Thesen zu Marx und dem Antisemitismus hier nicht in ihrer allgemeinen Tragweite nachgewiesen werden.[4] Als Teilbestätigung ihrer Gültigkeit soll hier gezeigt werden, wie der Marx‘sche Geldbegriff und die antisemitische Vorstellung des Juden die Genese des jeweils anderen erhellen können.
Dazu werde ich folgendermaßen vorgehen. Zunächst werde ich auf Marx´ Aufsatz Zur Judenfrage aus dem Jahr 1844 eingehen, in dem er die wichtigsten rechtlichen und politischen Fragen zum Verhältnis von Judentum und moderner Staatsbürgerschaft erörtert. In meinem Interpretationsvorschlag stellt dieser Aufsatz einen Versuch dar, das (Wieder-)Aufkommen des Antisemitismus inmitten der deutschen Gesellschaft am Anfang ihrer Modernisierung kritisch zu verstehen. In dieser Erwiderung auf die kurz zuvor erschienene Abhandlung von Bruno Bauer Die Judenfrage griff Marx die Neigung des radikalen Junghegelianers und des modernen Individuums überhaupt auf, die je eigene innere Spaltung in bourgeois und citoyen als einen äußeren Gegensatz zwischen sich selbst und dem Juden vorzustellen. Damit nahm er die viel spätere psychoanalytische Erklärung des Antisemitismus als unbewusster Projektion vorweg. Ich werde dafür argumentieren, dass in einem chronologisch geordneten Verzeichnis der wissenschaftlichen und kritischen Literatur zum modernen Antisemitismus die Rezension des jungen Marx zu Bauers Judenfrage als erster Titel erscheinen sollte.
Zweitens möchte ich zeigen, dass Marx´ Projekt einer „Kritik der Judenfrage“[5] weit davon entfernt ist, mit dieser frühen Polemik gegen Bruno Bauer abgeschlossen worden zu sein. In Wirklichkeit bildet es einen integralen, obwohl selten expliziten Bestandteil in seiner umfassendsten theoretischen Unternehmung: der Kritik der politischen Ökonomie. Das lässt sich nicht nur an einigen halbernsten Anspielungen zwischen den Zeilen des Kapitals belegen, sondern auch anhand einer Analyse seines grundlegenden kategorialen Gerüsts: Das Verhältnis zwischen Ware und Geld, wie Marx es im ersten Abschnitt des ersten Bandes des Kapital entwickelt, entspricht, so wird zu zeigen sein, demjenigen zwischen der christlichen Mehrheit und der jüdischen Minderheit der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, wie er es 25 Jahre zuvor in dem Artikel Zur Judenfrage beschrieben hatte.
Ein wichtiger Aspekt seiner Theorie des Fetischismus besteht bekanntlich darin, dass die Waren den gesellschaftlichen Charakter ihrer Produzenten widerspiegeln. Weniger beachtet ist indes der Umstand, dass so wie die Ware das bürgerliche Subjekt, so das Geld „den Juden“ repräsentiert, d.h. das jüdische Gespenst, das im Bewusstsein des bürgerlichen Subjekts und der antisemitischen Gesellschaft spukt.
Drittens möchte ich ein substanzielles Verständnis der auf den ersten Blick nur formalen Analogie zwischen der Kritik der Judenfrage und der der politischen Ökonomie ermöglichen. Zu diesem Zweck werde ich mich auf die soziale Genese der sehr alten, fast archetypischen Verbindung von Juden und Geld in der europäischen Wirtschaftskultur konzentrieren, im Hinblick aber auf die spezifische Bedeutung, die diese Verbindung im Bewusstsein der Menschen mit dem Übergang von der Agrar- und Feudalwirtschaft zur industriellen und kapitalistischen Wirtschaft angenommen hat.
Schließlich werde ich auf den christlichen Charakter eingehen, den Marx der säkularisierten, liberalen Industriegesellschaft und ihrer besonderen Herrschaftsform, dem Kapital, zuschreibt. Die Frage, ob der religiöse Kern der bürgerlichen Gesellschaft eher als „jüdisch“ oder als „christlich“ anzusehen ist, ist nur scheinbar theologisch. Auf dem Spiel stehen zwei radikal unterschiedliche Konzepte von Gesellschaftskritik: Der moderne Antisemitismus identifiziert das internationale Judentum als den Hauptagenten und -nutznießer der durch die bürgerlichen Revolutionen entfesselten undurchschaubaren ökonomischen Kräfte – dagegen zeigt Marx, dass diese Vorstellung auf einer verdinglichten Auffassung des Kapitals beruht, in deren Mittelpunkt die Vorstellung der Geldmacht steht. Anhand seiner kritischen Analyse der „objektiven Gedankenformen“ kapitalistisch produzierender Gesellschaften lässt sich die politische Substanz des modernen Antisemitismus in einem utopischen und zugleich reaktionären Vorschlag für eine endgültige Lösung der sozialen Frage identifizieren: Abschaffung des Geldes. Der historische Boden, auf dem sich diese politische Tendenz entwickelt, ist nicht so sehr die traditionelle christliche Abneigung gegen Juden, sondern vielmehr eine moderne, für die bürgerliche Gesellschaft typische Denkform. Aus Marx´ Sicht liegt daher das Entscheidende, um den wiederauflebenden Antisemitismus seiner Zeit zu verstehen, nicht in irgendwelchen jahrtausendealten Vorurteilen. Vielmehr stellen das Wiederaufleben dieser alten Vorurteile und die gesamten zeitgenössischen Debatten über die Judenfrage das augenfälligste Symptom einer gesellschaftlichen Pathologie der Erkenntnis dar, d.h. eines entstellten Selbstverständnisses der modernen Gesellschaft und eine gesellschaftlich verzerrte Form, in der diese ihre inneren Konflikte und die Probleme ihrer eigenen Emanzipation wahrnimmt.
2. Zur Judenfrage
„Judenfrage“ ist der zentrale Begriff des modernen Antisemitismus. Das Mittelalter hat sich keine Judenfrage gestellt. Zwar fehlte es in dieser Zeit nicht an Vorurteilen und Diskriminierungen gegen Juden. Aber die Juden mussten erst nach den bürgerlichen Revolutionen und nach ihrer eigenen Emanzipation zu einer „Frage“ werden. Die Judenfrage – als eine die gesamte Gemeinschaft unmittelbar betreffende und eine systematische oder endgültige Lösung erfordernde – ist allein eine Frage der bürgerlichen Gesellschaft.
...
_________________________
[1] Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1: Der Produktionsprozeß des Kapitals, MEW 23.
[2] Der immer noch häufig wiederholte Antisemitismusvorwurf gegen Marx hat eine Tradition, die spätestens in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs beginnt. Siehe Edmund Silberner, „Was Marx an Anti-Semite?“ Historia Judaica 2, Nr. 1 (1949): 352.
[3] Paulus von Tarsus, Brief an die Römer 2, 28.
[4] Für eine ausführlichere und detailliertere Untersuchung siehe Manuel Disegni, Critica della questione ebraica. Karl Marx e lantisemitismo, Torino: Bollati Boringhieri, 2024.
[5] Karl Marx, Zur Judenfrage, MEW 1, Berlin: Dietz Verlag, 1956, 348.
- Preis: 4.00 €
- Erscheinungsjahr: 2025